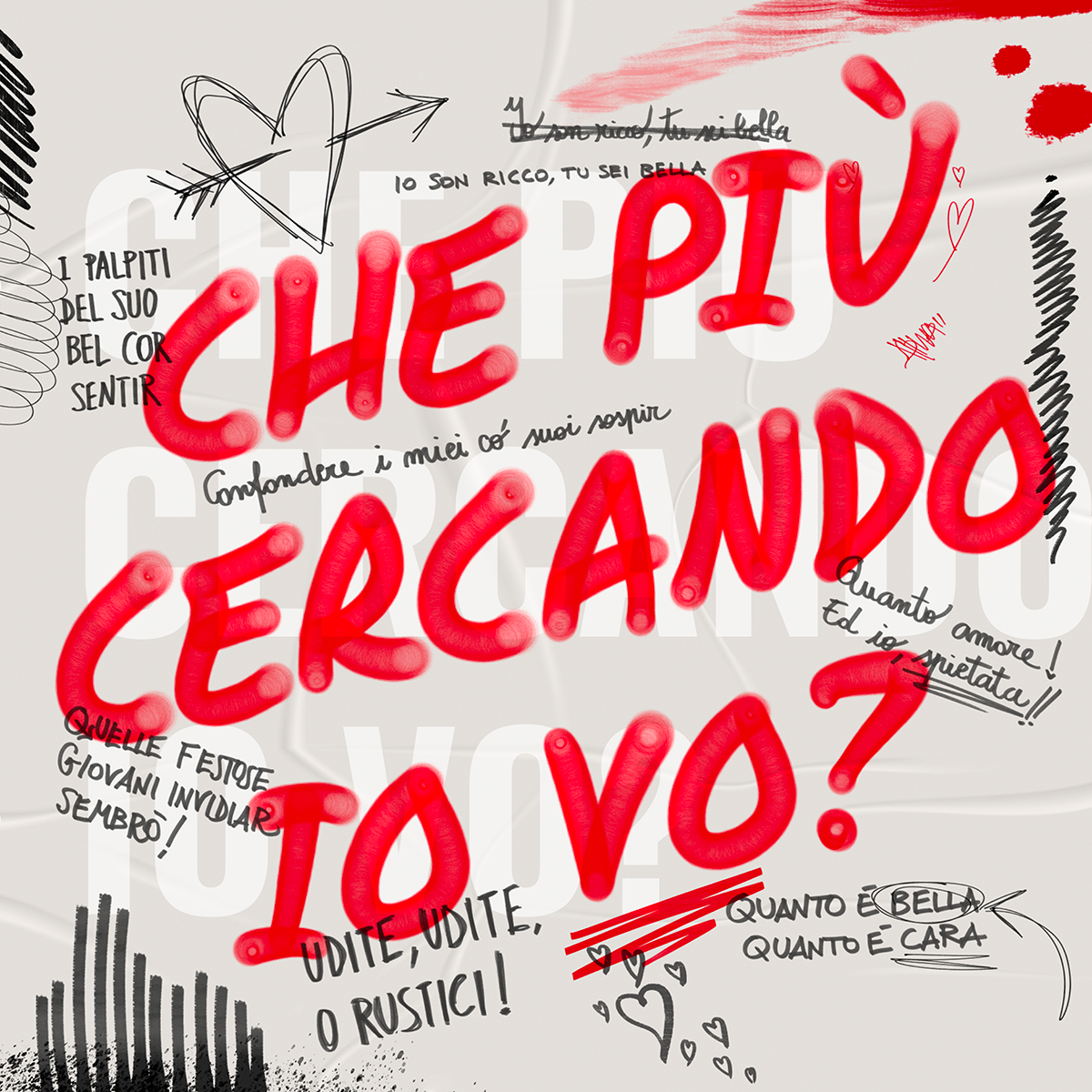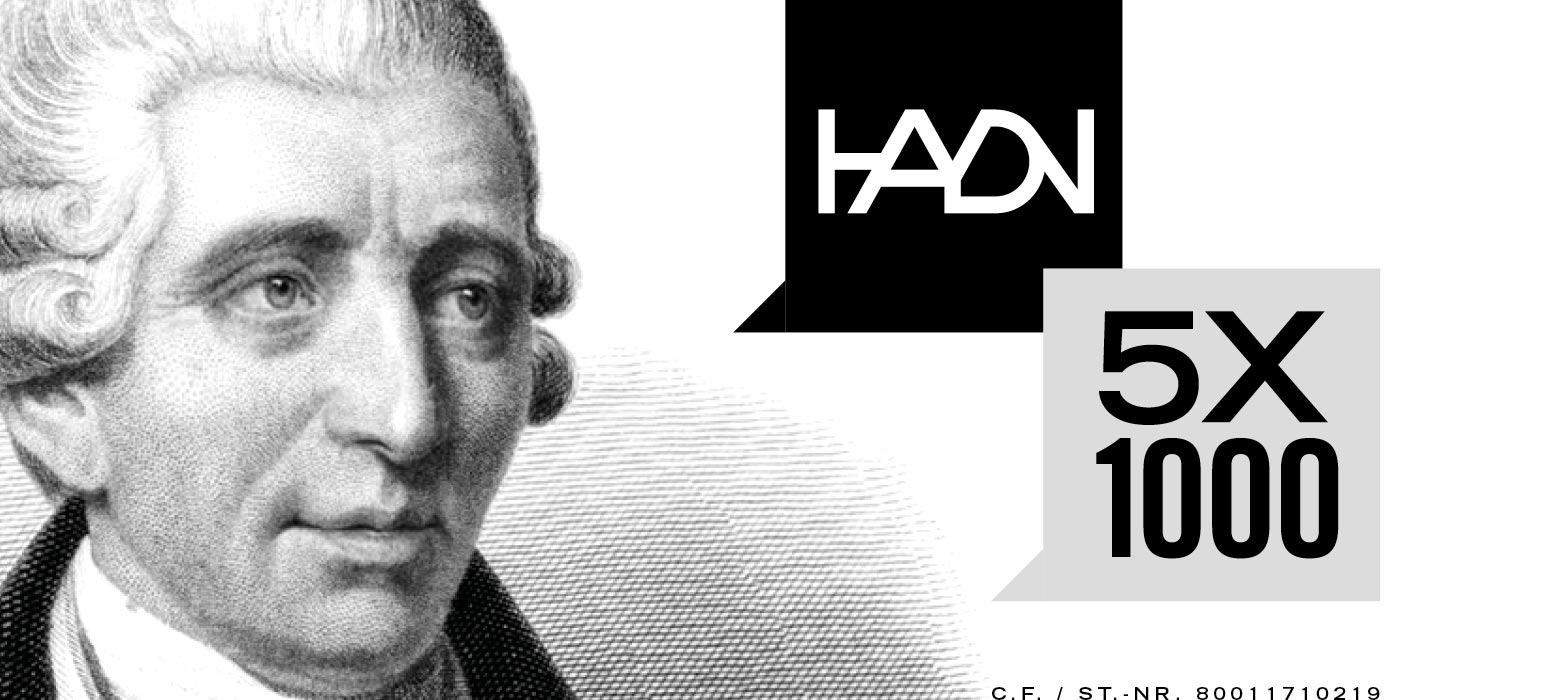Oper ist ein lebendiges Buch
veröffentlicht am
Dienstag
28 Oktober 2025
Roberto Catalano, Sie inszenieren schon seit langem Opern. Was macht das Genre Oper für Sie zeitlos, um nicht zu sagen „unsterblich“?
Oper lebt von Gefühlen, und Gefühle sind und bleiben unsterblich. Die Musik hält Emotionen fest, drückt sie aus und verleiht ihnen noch mehr Kraft. Deshalb denke ich, dass diese Geschichten auch heute noch bewegen, greifbar und zeitlos sind. Opern sind wie Bücher, die bei jeder Begegnung neu zum Leben erwachen und Menschen immer wieder auf andere Weise berühren. Liest man diese Bücher mit 20 Jahren, entdeckt man darin etwas, das man mit 40 wohl nicht mehr empfinden wird. Die Oper hat für mich, wenn man sie erlebt und hört, denselben Effekt. In den Tiefen der Musik schlummern aufwühlende Gefühle, die berühren und immer berühren werden.
Wie wichtig sind Ihnen bei der Inszenierung einer Oper die Gedanken, Notizen und das Umfeld des Komponisten – in diesem Falle Donizettis?
Natürlich beeinflussen mich all diese Dinge. Auch wenn das Libretto die Grundlage jeder Inszenierung bildet, finden sich in Briefwechseln und Notizen des Komponisten oft Anstöße, die den dramaturgischen Aufbau in Gang setzen.

Und wie viel steht für Sie in den Noten geschrieben?
Die Noten und die dazugehörigen Anmerkungen weisen den Weg, um den Absichten des Komponisten so treu wie möglich zu bleiben. Das schließt jedoch die unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten nicht aus, die das Libretto bietet. Die geschriebenen Worte bleiben dieselben, doch wir, die sie lesen, werden älter und verändern uns. Erstarrung und Stillstand passen nicht zur Oper. Ich finde es besonders anregend, mich im Laufe der Zeit immer wieder mit demselben Werk auseinanderzusetzen, denn auch wenn man glaubt, es gleich zu inszenieren, verändert sich die Lesart doch jedes Mal.
Kann man die Kunst überhaupt getrennt von ihrem Schöpfer sehen und verstehen?
Das ist eine sehr schwierige Frage, auf die ich keine abschließende Antwort habe. Befasst man sich mit dem Schöpfer eines Werks und kennt man ihn, kann sich der Blick auf das Werk erweitern. Man kann sich einem Werk aber auch ganz unvoreingenommen nähern und es ohne biografische Informationen über den Komponisten genießen. Kunst steht der Menschheit offen, unabhängig davon, wer sie schafft.
Sie haben Philosophie und Ethik studiert. Beeinflusst das Ihr Verständnis von Musik und Oper und in weiterer Folge Ihre Inszenierungen?
Philosophie und Ethik haben mir weniger geholfen, Musik zu verstehen, als vielmehr, Fragen zu stellen. Das Erarbeiten einer Dramaturgie setzt ständiges Hinterfragen voraus. Manchmal schließen sich die Kreise schnell, manchmal nicht. Man muss sich der Musik und dem geschriebenen Wort hingeben und versuchen, das Werk mit den emotionalen Mitteln zu ergründen, die einem zur Verfügung stehen.
Sie sind auch als Tänzer und Pantomime auf der Bühne gestanden und haben eigene Stücke geschrieben. Fließen diese Erfahrungen in Ihre Regiearbeit ein?
Die Arbeit auf der Bühne hat mir sehr geholfen. Da ich keine Schauspielschule besucht habe, verdanke ich vieles den Erfahrungen, die ich als 14-Jähriger gemacht habe. Später habe ich durch das Beobachten anderer Regisseure und ein wachsendes Verständnis für die Sprache der Bühne viele Werkzeuge gewonnen, um mich weiterzuentwickeln.
Ihre aktuelle Inszenierung von „L’elisir d’amore“ in Bozen beginnt mit einer Rückblende – überhaupt kommen einige Zeitsprünge vor …
Ja, meine Inszenierung beginnt mit einem kleinen Mädchen, das von einer Schaukel gestoßen wird, durch eine unfreundliche Geste eines Jungen, dem sie vertraut hat. Das Mädchen heißt Adina, und von diesem Moment an ist jede ihrer Beziehungen von der Angst geprägt, erneut verraten zu werden …

„L’elisir d’amore“ zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Melodramen, die Arie „Una furtiva lagrima“ zu den heimlichen „Hymnen“. Ist das ein Fluch oder ein Segen?
Die Arie „Una furtiva lagrima“ ist sicher ein heiß ersehntes Highlight, wenn man so will. Sie schürt hohe Erwartungen und setzt unter Druck. Ich könnte aber nicht sagen, ob das ein Segen oder ein Fluch ist. Solange es eine sehnsuchtsvolle Erwartung nach solchem Kulturerbe gibt, bin ich hoffnungsfroh!
Abschließend noch eine Frage: Worauf freuen Sie sich bei einem Opernprojekt am meisten – auf die Probenarbeit, die Premiere oder das Publikum?
Auf alle drei Dinge! Ich würde jedoch noch eine vierte hinzufügen: die kreative Phase. Jene Phase, in der man nach der Initialzündung sucht, die Bewegung in den dramaturgischen Aufbau bringt und in der man im Team daran arbeitet, jene Welt zu erschaffen, die später von den Darsteller:innen bewohnt wird. Auch wenn die Zeit für eine Produktion immer kürzer wird, ist die kreative die „langsamste“ Phase der Arbeit an einer Aufführung. Und heute ist die Langsamkeit das Wertvollste, was wir uns leisten und gönnen dürfen.