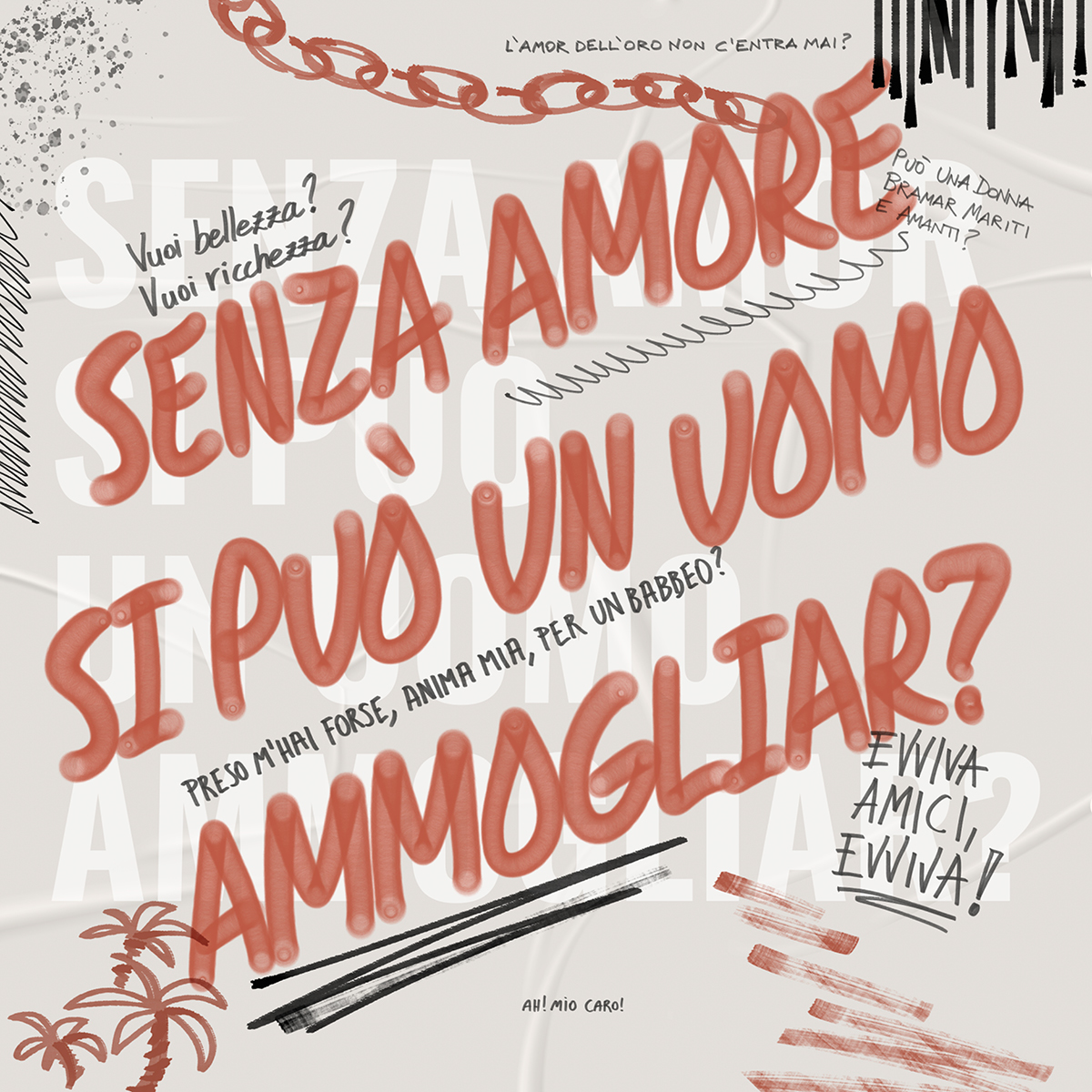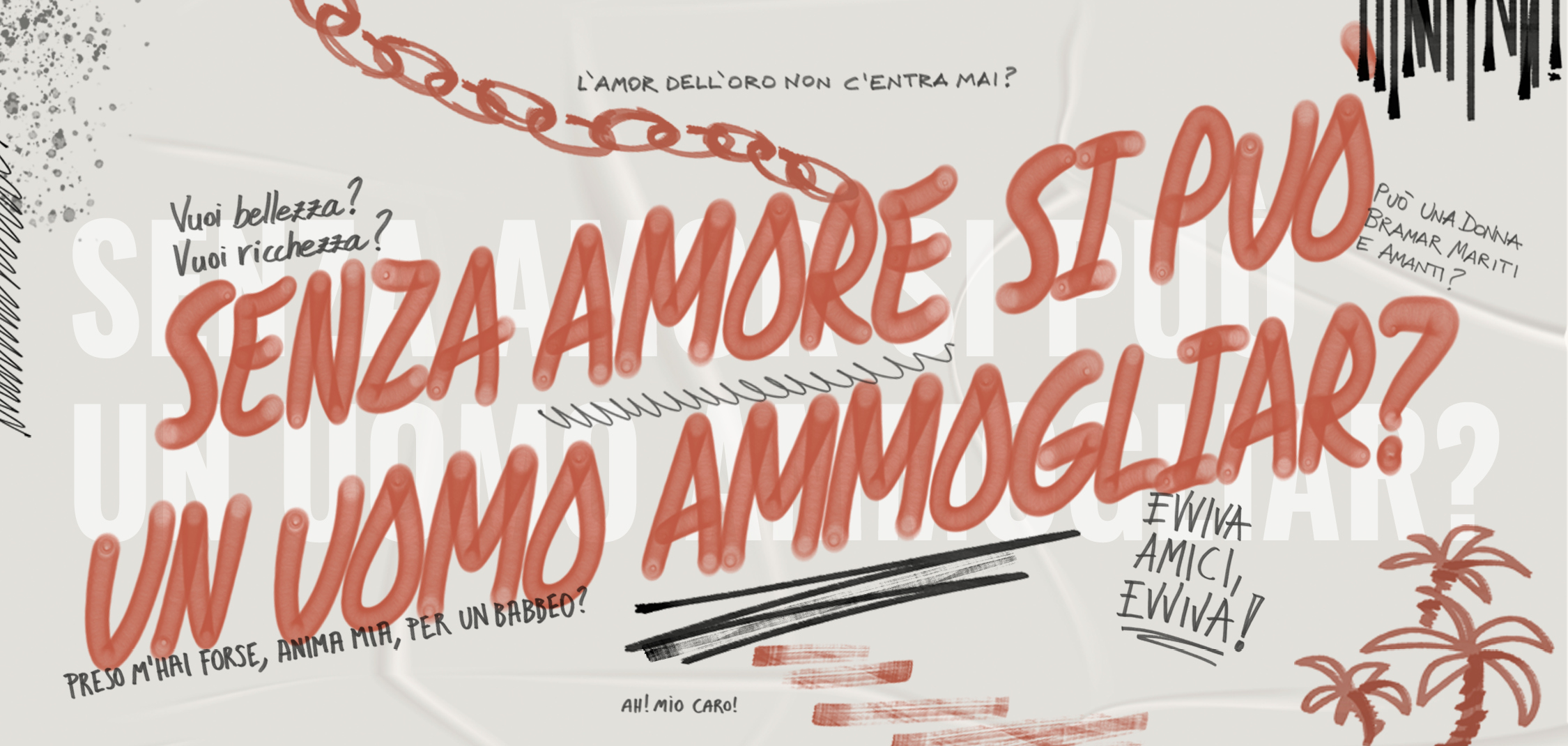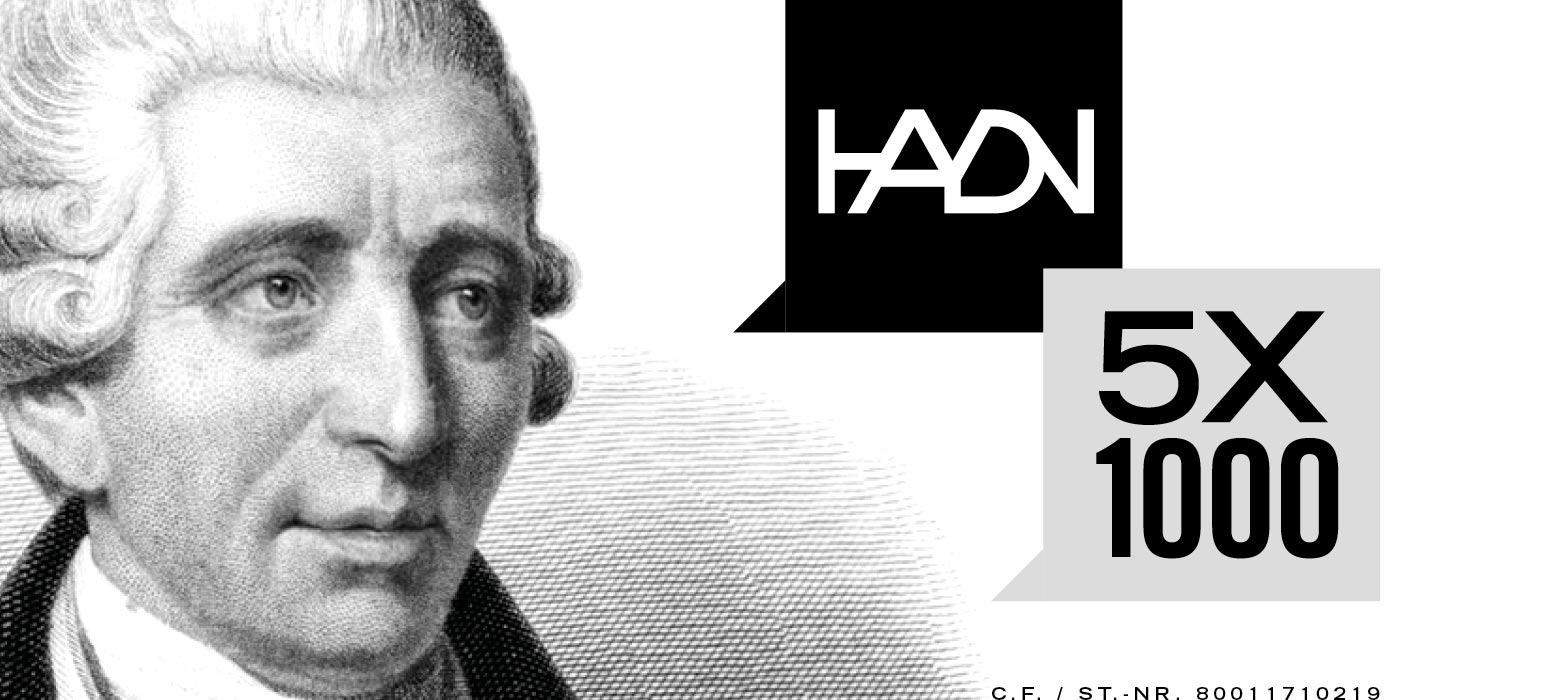So kann man sich irren. In Algier seien Frauen nur dazu geboren, ihren Herren zu dienen, behauptet der Chor schon nach der Ouvertüre und dann kommt doch alles ganz anders. Während der Herrscher der arabischen Korsarenfestung noch verliebt die Augen verdreht, hat die schlaue Isabella schon längst sämtliche Fäden in der Hand. Dabei war die Italienerin erst kurz zuvor als Gefangene in die Stadt gebracht worden, und soll in dessen Serail – im frühen 19. Jahrhundert der Kulminationspunkt europäischer Vorstellungen vom Orient als geheimnisvollem erotischem und exotischem Ort – eingesperrt werden. Der Löwe wird zum Esel, den alle bald nur noch „Papatacci” („iss und schweig”) nennen, und die Männerwelt steht Kopf. Der Romancier Stendhal bezeichnete Rossinis 1813 in Venedig uraufgeführte Opera buffa „L'italiana in Algeri” als eine „organisierte und vollkommene Verrücktheit”. Der rasante Plot sprengt – auch mit dadaesken Lautmalereien wie „drin drin”, „bum bum” oder „tak tak” – alle Fesseln. „Ich glaubte, dass die Venezianer mich für verrückt halten würden, nachdem sie meine Oper gehört haben; nun stellt sich heraus: Sie sind noch verrückter als ich!“, wunderte sich der Komponist – laut Heinrich Heine „ein Vesuv, der strahlende Blumen speit“ – nach der Premiere im Teatro San Benedetto, bei der das Publikum seine mit Patriotismus angereicherte, tolldreiste Liebesburleske begeistert gefeiert hatte.